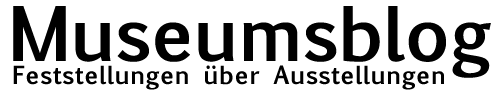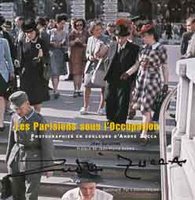Geschrieben von Nina Gorgus am 18. Juli 2008 10:22
Es geht um ein heikles, aber wichtiges Thema: auch die sanitären Anlagen eines Museums sollten einem gewissen Niveau doch folgen. Neulich in Paris wollte ich vor dem Besuch der Ausstellungen zunächst einem dringenden Bedürfnis nachkommen. Also gehe ich ins Foyer und folge den Schildern. Hierzu muss die Treppen am Musik-Zylinder nehmen – die KennerInnen wissen nun natürlich, dass ich mich im Musée du quai Branly befinde. Ich gehe zwei Etagen die Treppe hinunter und komme auf einen schmalen, dunklen Gang. Hier erkenne ich die richtige Richtung an den Schlangen: vor beiden Toiletten steht jeweils eine halbe Schulklasse, hinzu kommen die anderen BesucherInnen. Ich schaue nach, wieviel Toiletten eigentlich da sind, um die Wartezeit einschätzen zu können. Vier Toiletten habe ich gezählt! Vier Damentoiletten in einem Museum, das Millionen gekostet hat! Vier! Müssen Stararchitekten nie aufs Klo? Da ich unten keine weiteren Hinweisschilder auf Toiletten gesehen hatte, begebe ich mich in die Ausstellung, in der Hoffnung, dort etwas zu finden. Der Weg ist auch ausgeschildert – doch mein Ziel wegen Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Und die nächste Toilette befindet sich einen Stock höher, für die Treppe muss man wieder ein ganzes Stück zurückgehen… Es ist aber nochmals alles gut gegangen. Aber der Museumsbesuch erhält dadurch keinen optimalen Auftakt.
Geschrieben von Nina Gorgus am 10. Juni 2008 10:25
In Paris kann man den Mai 1968 hören: Im Rathaus des 18. Arrondissement wurde eine typische Wohnung konstruiert, wie sie im Mai 1968 eine vierköpfige Arbeiterfamilie bewohnt haben könnte. Die Besucherin erwartet in den Räumen ein „parcours ludique LA BANDE SON DE MAI 68„. In der Küche hört maman Charles Aznavour, während beim Sohn von Jacques Dutronc „Il est 5 heures Paris s’éveille“ oder von Steppenwolf „Born to be wild“ läuft. Ergänzt werden die Hörräume von Plakaten, Fotografien, Zeitungsausschnitten, authentischen Straßengeräuschen von Demonstrationen, von Filmausschnitten – wie etwa die Nachrichtensendungen von Mai 1968 oder Episoden der Comicserie Les Shadoks, die damals entstand. Bevor man in die Wohnung kommt, muss man erst einmal einen „panier à salade“ queren – einen Polizeiwagen, in dem berühmte oder weniger berühmte Zeitgenossen über ihren Lieblingshit von Mai 68 reden. Ich finde, das klingt gut.
Hier kann man filmische Interviews ansehen, in denen etwa der frühere Premierminister Lionel Jospin oder Georges Moustaki über ihre Lieblingslieder von Mai 68 reden. Und hier steht etwas über die Ausstellung in Le Monde.
Noch bis zum 5. Juli.
Mairie du 18e,
1, place Jules Joffrin
75018 Paris, Metro Jules Joffrin
von Montag -Freitag: 8.30 bis 17 Uhr (Do bis 19.30 Uhr) und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr
Geschrieben von Eva C.-K am 2. Juni 2008 16:45
Noch bis Ende des Monats zeigt das Pariser Grand Palais eine Ausstellung über Marie-Antoinette. Mehrere Biografien aber vor allem der Film von Sofia Coppola haben die unglückliche Königin wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.
Die Szenografie des Kanadiers Robert Carsen, ist überaus geglückt. Man merkt, dass Carson vom Theater kommt, er weiss die einzelnen Stationen effektvoll in Szene zu setzen. Die Ausstellung zieht sich durch Zimmerfluchten, zuerst in fröhlichem, warmen Rot wird die unbeschwerte Kindheit der Erzherzogin am Wiener Hof dargestellt, bevor zartes Lichtblau ihre ersten Jahre am französischen Hof symbolisiert. Kühler aber dennoch hell und unbeschwert ist der Hintrgrund. Die Bilder der französischen Königsfamilie zeigen, ausser dem alternden Louis XV, Halbwüchsige, fast noch Kinder (Louis XVI, seine Brüder, Schwestern und Schwägerinnen), ein Umfeld in dem die lebenslustige Österreicherin anfangs bewundert und geliebt wird. Zahllose Bilder, Büsten, Stiche sollen die Thronfolgerin auch dem einfachen Volk nahebringen. Immer toller und aufwendiger werden Vergnügungen, Moden, Frisuren bevor die Zeit der neuen (stilisierten) Einfachheit kommt. Zartes Grün umgibt die Möbel und Dekorationsobjekte die Marie-Antoinette ohne Unterlass für ihre verschiedenen Schlösser und vor allem für ihr geliebtes Trianon anfertigen lässt. Eine Theaterkulisse dient als bukolischer Rahmen für die Porträts ihres Freundeskreises der sie nach und nach dem offiziellen und einflussreichen Hofadel entfremdet. Die Farben verdüstern sich. Auch die Porträts Marie-Antoinettes im Kreise ihrer Kinder vermögen die öffentliche Meinung nicht mehr zu beeinflussen. Immer dunkler und leerer wird es um sie – und um den Besucher. Der letzte Raum ist schwarz, an den Wänden rechter Hand, die Karikaturen, Spott- und Hassschriften, auf der linken Seite Auszüge aus ihren letzten Briefen die immer hoffnungsloser werden. Einige wenige, armselige Gegenstände zeugen von der Härte ihrer Gefangenschaft. Und schliesslich an der dem Eingang gegenüberliegenden Schmalseite von einem Rahmen in Form eines dunkelroten Schafottes umgeben, ihr letztes Bild, eine kleine Zeichnung die sie auf dem Schinderkarren zeigt. Tragisches Ende der Geschichte einer lebenslustigen und unkonventionellen jungen Frau (sie ist 38 Jahre alt als sie geköpft wird).
Die Objekte und Bilder sind geschickt gewählt, vielfältig ohne den Besucher zu erdrücken, die Texte sind gut lesbar, nicht zu lange aber informativ, zeitgenössische Musik ergänzt die visuellen Eindrücke. Eine, meiner Meinung nach, beispielhafte Ausstellung über eine historische Persönlichkeit die dazu anregt, sich im Anschluss in eine der zahlreichen Biografien zu vertiefen – besonders empfehlenswert jene von Stefan Zweig!
Geschrieben von Eva C.-K am 30. Mai 2008 18:54
Wer mag wohl die Beschriftungen in der erst kürzlich generalrenovierten und neu aufgestellten Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) verfasst haben? Die einzigartige Abgusssammlung romanischer und gotischer Architektur verleitet den neugierigen Besucher dazu, mehr zur Ikonographie der meist religiösen Szenen wissen zu wollen. Glücklich eine Beschriftung entdeckt zu haben, geht erwähnter Besucher in die Knie um sie zu lesen. Was erfährt er? Woher die Moulage stammt, o.k., wer die Abformung gemacht hat – was soll der Besucher wohl damit anfangen? – wann die Abformung in die Sammlung aufgenommen wurde – siehe oben…. und ihre Inventarnummer.
Schlussfolgerung: entweder die Kuratoren überschätzen die Besucher und halten sie für Spezialisten mittelalterlicher Ikonographie oder – was wohl eher zu vermuten ist – sie haben diese ewige Neugier der Besucher einfach satt!
Geschrieben von Nina Gorgus am 30. Mai 2008 09:32
Gestern kam auf Arte zu später Stunde der Dokumentarfilm „Museumsbusiness“.
Es ging um die Expansion der großen Museen und Stiftungen wie Guggenheim und Louvre, also um Bilbao, Atlanta und Abu Dhabi. Laut Programminfo sollte gefragt werden:
„Handelt es sich hierbei um gefährliche Kommerzialisierung oder Vermarktung der Kultur? Oder ist das Herausbilden eines gewissen Kulturbusiness eher positiv, um die Sammlungen zur Geltung zu bringen, neues Publikum zu gewinnen und kulturelle Einzugsgebiete zu erweitern? Bietet es den Institutionen nicht auch die Möglichkeit, ihre Mittel aufzustocken?“
Dazu wurden Thomas Krens, Direktor der Guggenheim-Stiftung, Henri Loyrette, Präsident des Louvre, der damalige zuständige baskische Kulturminister in Bilbao, Mitarbeiter von France-Muséums, der Agentur, die mit der Abwicklung des Louvre Abu Dhabi betraut ist, der Scheich in Abu Dhabi und noch einige mehr befragt. Interessant war der Fall von Bilbao, weil klar wurde, dass es sich um eine baskische Initiative handelte, die sich auch durchzusetzen wußte und allein die Aufwertung der Region im Visier hatte.
Eigentlich, und das betrifft vor allem den Louvre und seinen Expansionsbestrebungen, kamen im Film nur die Personen zu Wort, die wortreich begründeten, dass es sich natürlich um keinen Ausverkauf der Kunst handle, sondern nur um eine bessere Positionierung der Museen. Den positiven Stimmen stand ganz alleine der Kunsthistoriker und Kritiker an den Expansionsplänen des Louvre, Didier Rykner (zugleich Betreiber von la tribune de l’art) gegenüber. Obwohl die beiden französichen Autoren Sylvain Bergère und Stéphane Osmont anfangs die Petition gegen die Expansionspläne des Louvre erwähnten. Wieso kamen hiervon nicht mehr Kritiker zu Wort? Etwa die Kunsthistoriker Jean Clair, Françoise Cachin oder Philippe de Montebello, (noch) Direktor des Metropolitain Museum in New York, der sich dezidiert gegen die Politik der Depandancen ausgesprochen hat? Wollten die nicht oder durften die nicht? Schade, das hätte den Film ausgewogener gemacht. So war mir der Film, mit Verlaub gesagt, zu tendenziös. Und irgendwie auch selbst entlarvend. Wenn wir es nicht tun, so sagte der Leiter der Agentur France-Muséums, dann machen es die anderen. (Heißt das nicht auch übersetzt: die anderen können es nicht so gut wie wir?) Und die Sprecherin des Films sagte: Wenn Frankreich im internationalen Wettbewerb einen Vorsprung hat, sollte es ihn auch nutzen. Um was geht es hier eigentlich? Etwa noch um Kunst?
Den Film kann man sich bei arte hier noch 7 Tage lang anschauen.
Geschrieben von Nina Gorgus am 28. Mai 2008 14:43
Neulich wurde hier im Museumsblog über eine geplante Ausstellung in Verona berichtet, in der Werke aus dem Louvre zu sehen sein sollten, die zuvor noch nie das Gebäude verlassen hatten und bei der es um viel Geld geht. Nun berichtet der französischsprachige Blog la tribune de l’art (der freundlicherweise gleich die englische Übersetzung mitliefert), dass diese Ausstellung abgesagt wurde; offiziell heißt es dazu:
“Given its present status, there is not enough time to organize this important exhibition, if one takes into account the works required as well as all of the technical, administrative and legal conditions needed to guarantee the arrival, safety and conservation of the masterpieces.”
La tribune de l’art hat vom zuständigen Kurator des Louvre erfahren, dass die Werke aufgrund von fehlenden Sicherheitsvorrichtungen in Verona vom Louvre zurückgezogen worden seien, und die Ausstellung nicht nur aufgeschoben sei.
Die Ausstellung findet also definitiv nicht statt. Sollte die Kritik, wie sie tribune de l’art hier formulierte, etwa angekommen sein?
Geschrieben von Nina Gorgus am 13. Mai 2008 11:37
„Ne visitez pas l’Exposition Coloniale!“ so hieß es in einer Veröffentlichung der Surrealisten gegen die große Kolonialausstellung in Paris 1931. Nicht nur sie, sondern eine Vielzahl von Franzosen und Immigranten protestierten gegen die Ausstellung, die die Kolonien Frankreichs sowie das Mutterland als ein großes Ganzes feiern sollte – was es natürlich nie war. Über 75 Jahre später sollte man sich schon diese Ausstellung anschauen, die nun in der Cité nationale de l’histoire de l’immigration stattfindet: 1931. Les étrangers au temps de l’exposition coloniale ist eine Hommage an die damals über drei Millionen lebenden Fremden in Frankreich und der Versuch, die andere, die soziale Realität zur Zeit der Ausstellung darzustellen.
Ein Ausstellungsstück ist der Palais de la Porte dorée selbst, war er doch damals schon Teil der Kolonialschau. Die Ausstellung verspricht interessant zu werden, gehört doch der Schweizer Jacques Hainard zu den Kuratoren.
Hier findet sich ein ausführlicher, bebilderter Text von Brigitta Kuster über die Ausstellung von 1931.
Geschrieben von Eva C.-K am 28. April 2008 18:17


Kleiner Tip für die nächste Korsika Reise. Im malerischen Ort Nonza an der Westküste des Cap Corse und ca. 20 km von Saint Florent entfernt, lädt ein hübsch gemachtes kleines „Ecomuseum“ zu einer Entdeckung der Zitrusfrucht Cédrat ein. Diese Frucht von der man hauptsächlich die Schale zur Herstellung von Zitronat, Likören und als ätherisches Öl in der Parfumerie verwendet, wird in terrassenartig angelegten Gärten kultiviert und trug früher zum Wohlstand der Region bei. Das überschaubare Museum ist in frischen „Zitrusfarben“ gehalten, Videos, Fotos, alte Reklameschilder, Bordtagebücher die den Handel belegen und ein „Geruchs-Quiz“ machen den Besuch vergnüglich. Schade dass alle Texte nur auf Französisch sind und nicht einmal ein Blatt mit englischen Übersetzungen aufliegt. Aber das kann ja noch werden…
Geschrieben von Nina Gorgus am 24. April 2008 10:08
Der Louvre steht mal wieder in der Kritik. Dieses Mal geht es um 130 Leihgaben für eine Ausstellung in Verona. Dazu der Kunsthistoriker Didier Rykner in seinem Blog la tribune de l’art:
„The Louvre is still offering great deals. If you are a millionaire and would like to organize an exhibition, this is definitely the place to come: ask for a couple of masterpieces and it will see you get them on condition you pay the right price. It seems that only the Mona Lisa is not for rent. At least officially. But you can have any other Leonardo you want.“
Der Hintergrund: die Leihgaben gehen nicht an ein Museum, sondern werden für vier Millionen Euro einer privaten Gesellschaft überlassen, die die Ausstellung mit Bildern von Goya, Botticelli, Véronèse, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Vélasquez, Greco, Raphaël… ausrichtet. Wohlgemerkt handelt es sich dabei um Bilder, die in den Ausstellungssälen hängen und die das Museum so gut wie nie verlassen haben, darunter auch das „Porträt einer jungen Dame“ (La belle Ferronière) von Leonardo da Vinci. Auf die Frage, warum nun plötzlich Werke ausgeliehen werden, die sonst nie das Gebäude verlassen, sagte ein Sprecher des Louvre der Zeitung Le Monde: „Niemand hatte sie bisher angefragt“, und verweist auf den wissenschaftlichen Charakter der Ausstellung. Andere halten diese Zusammenstellung für einen Vorwand. Mit dem Geld möchte der Louvre Werke restaurieren und weitere Kataloge editieren. Ein Teil des Geldes soll für Abu Dhabi auch schon eingegangen sein. Gleich mal nachschauen, ob die Eintrittspreise im Louvre niedriger geworden sind!
Geschrieben von Eva C.-K am 14. April 2008 15:37
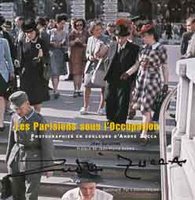
Die Bibliothèque historique de la ville de Paris widmet eine Ausstellung dem Fotografen André Zucca (1897-1973). Bis zum 1. Juli kann man in der rue Mahler 200 Bilder sehen, die Zucca während der Bessatzungszeit in Paris aufgenommen hat: im Luxembourg Park spielende Kinder, Musiker der Wehrmacht bei einem open-air Konzert, elegante Radfahrerinnen etc. Die Kritik richtet sich nicht gegen das Interesse dieser umfangreichen Fotoausstellung sondern gegen das Fehlen jeglichen Hinweises auf den Kontext: André Zucca arbeitete ausschliesslich für die Zeitschrift „Signal“, Publikation im Dienste der deutschen Wehrmacht, veröffentlicht in 20 Sprachen und mit einer Auflage von 2,5 Millionen, davon 800.000 in Frankreich. Zucca produzierte für „Signal“ Dutzende von Reportagen über die Verheerungen der alliierten Bombenangriffe in Frankreich, und auch die hier gezeigten idyllischen Bilder des „Alltagslebens“ im Paris der 40er Jahre. Einer der Vorwürfe ist, dass nur Datum und Ort der Bilder angegeben sind, kein weiterer Hinweis aber auf ihren spezifischen Kontext. Erst Proteste der Besucher haben dazu geführt, dass ein Blatt bei der Kasse aufliegt in dem man nachlesen kann, dass Zucca im Auftrag der Nazizeitschrift gearbeitet und die „Realität der Okkupation in ihren dramatischen Aspekten“ ausgeklammert hat. Jean Derens, Direktor der Bibliothek, hält dies für ausreichend. Wenn ein Besucher nicht wisse was die Okkupation bedeutet hat, sei dies bedauerlich, aber man könne nicht jedesmal alles wieder erklären….
Kulturelle Welten schreibt hier darüber.