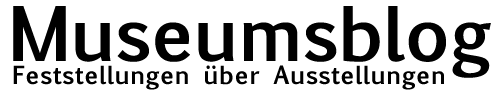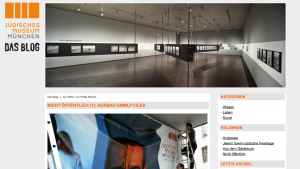Geschrieben von Nina Gorgus am 8. Februar 2010 10:50
 Ein echter Genuss ist die Ausstellung Koscher & Co. Über Essen und Religion im Jüdischen Museum in Berlin: der Genuss beruht auf einer spannenden Ausstellungsidee, die mit schönen Objekten kongenial umgesetzt wurde.
Ein echter Genuss ist die Ausstellung Koscher & Co. Über Essen und Religion im Jüdischen Museum in Berlin: der Genuss beruht auf einer spannenden Ausstellungsidee, die mit schönen Objekten kongenial umgesetzt wurde.
Doch von vorne: Am Eingang der Ausstellung bekommt man von der netten Dame einen Löffel in die Hand gedrückt. Mit diesem Löffel, so erklärt sie, kann man Rezepte einsammeln, in dem man ihn auf einen dafür bereitgestellten Teller streicht. Die Rezepte können zu Hause dann im Internet abgerufen werden. Das funktioniert und macht Spass, blinkt doch der Teller immer so schön auf, wenn der Löffel über ihn streift, so dass man bei der Sache bleibt, um ja nicht den nächsten Teller zu verpassen.
 Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Verhältnis von Essen und Religion. Warum essen Menschen so unterschiedliche Sachen und warum nicht? Warum gilt manche Nahrung, manches Tier als rein und warum nicht, sind die Hauptfragen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Verhältnis von Essen und Religion. Warum essen Menschen so unterschiedliche Sachen und warum nicht? Warum gilt manche Nahrung, manches Tier als rein und warum nicht, sind die Hauptfragen.
Die jüdischen Speisegesetze, die Kaschrut, werden ergänzt um einen Blick auf christliche, hinduistische und islamische Traditionen. In zehn Gängen wird uns die Ausstellung serviert. Verbote wie Gebote spielen eine Rolle, hauptsächlich aber der identitätsstiftende Aspekt, den der Soziologe Georg Simmel hier so schön einmal beschrieben hat. Die Religion wird sozusagen mitgegessen. Die Ausstellung fängt bei der biblischen Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva an – visualisiert mit zwei Statuen, flankiert von einer Parade reiner und unreiner Tiere.
 Dem Raum Eden folgen Gesetz, Opfer, Fleisch, Brot, Wein, „Mahl“, Genuss und Verzicht, Brot des Elends und Identitäten – hier sind wir bei der Gegenwart angelangt.
Dem Raum Eden folgen Gesetz, Opfer, Fleisch, Brot, Wein, „Mahl“, Genuss und Verzicht, Brot des Elends und Identitäten – hier sind wir bei der Gegenwart angelangt.
Der Genuss, die sinnlichen Gaumenfreunden und Symbole in der Küche werden vielgestaltig präsentiert: der Bogen spannt sich dabei von Gemälden, Fotografien, rituelle Gegenständen, alltäglichen Küchenutensilien zu handlungsüblichen Nahrungsmitteln aus der Gegenwart. Es macht Spass, sich in die Inhalte zu vertiefen, weil die Texte gut geschrieben sind und auch in die Tiefe gehen. Viele Fragen werden beantwortet, auch die, die man sich so gar nicht gestellt hätte (- etwa wie sich das koscher essen mit den tierischen Ungeziefer im Salat vereinbaren lässt, eigentlich ein interaktive Station für Kinder…)
Die Ausstellung ist, (um bei den Begrifflichkeiten des Essens zu bleiben) keine leichte Kost, aber auch nicht zu schwer verdaulich.
 Auch das Auge isst ja bekanntlich mit: Die 10 Räume haben alle ein eigenes Thema, das sich in Farben, oder in Ton- oder Bild installationen widerspiegelt. Sehr schön integriert sind die Medien: mal füllen Hör-Installationen einen ganzen Raum. Auf Monitoren, die zwischen die Vitrinen unauffällig eingepasst sind, kann man mit sich zum Beispiel Filmausschnitte ansehen. Sehr schön ist die Installation eines Tisches, an dem gemeinsam gegessen wird.
Auch das Auge isst ja bekanntlich mit: Die 10 Räume haben alle ein eigenes Thema, das sich in Farben, oder in Ton- oder Bild installationen widerspiegelt. Sehr schön integriert sind die Medien: mal füllen Hör-Installationen einen ganzen Raum. Auf Monitoren, die zwischen die Vitrinen unauffällig eingepasst sind, kann man mit sich zum Beispiel Filmausschnitte ansehen. Sehr schön ist die Installation eines Tisches, an dem gemeinsam gegessen wird.
Besonders beeindruckend ist auch der schlicht gehaltene Raum, in dem es um die Einhaltung der Speisegesetze während der NS-Zeit geht – sichtbar gemacht vor allem mit damals ausgegegeben Essenskarten mit unvorstellbaren Streichungen.
Die Ausstellung ist noch bis Ende Februar zu sehen und unbedingt zu empfehlen. Es ist damit zu rechnen, dass Sie am Ende Appetit bekommen haben – vor allem wenn Sie sich noch die Videointerviews am Ende der Ausstellung anschauen, in denen die interviewten Personen die jüdischen Speisegesetze für ihr Leben und Glauben erläutern. Abhilfe tut dann das museumseigene Cafe, und auf dem Weg dahin kann man sich an koscheren Gummibärchen aus dem Automat erfreuen.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, Projektleiter der Ausstellung ist Bodo-Michael Baumunk, die Gestaltung stammt von Norbert W. Hinterberger und Catarina Popp.
Hier und hier können noch Ausstellungsrezensionen gelesen werden.