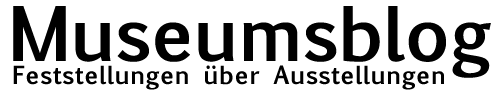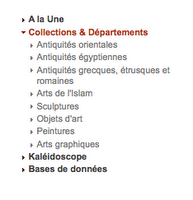Ausstellungswürdig?
Was ist guter Geschmack? Spätestens seit Pierre Bourdieu wissen wir ja, wie sich Geschmack ausbildet. Doch wie sehen die Dinge des schlechten Geschmacks aus? Dieser Frage geht das Werkbundarchiv im Museum der Dinge in der Ausstellung Böse Dinge. Eine Enzyklopädie des Ungeschmacks in Berlin nach.
Im Zentrum der Ausstellung stehen die Geschmacks-Kategorien von Gustav E. Pazaurek, Museumsdirektor im Landesgewerbemuseum in Stuttgart, der 1909 dort die „Abteilung der Geschmacksverirrungen“ einrichtete.
Dinge zeugen nach Pazaurek entweder von gutem oder schlechtem Geschmack. So heisst es auf der Ausstellungsseite des Museums der Dinge:
„Die strafrechtlichen Kategorien, mit denen Pazaurek die Dinge etikettierte, lesen sich wie eine Metaphorik des Bösen. Die Bösartigkeit der Dinge bezieht sich dabei nicht auf Taten, die mit ihnen ausgeführt werden könnten, nicht auf ihren Zweck oder ihren Zeichencharakter, sondern auf das Böse bzw. Schlechte, das sich in ihrer Ausführung, Gestaltung und in ihrer Funktionsfähigkeit manifestiert.“
Der Werkbund stellte einige der von Pazaurek gesammelten Stücke zeitgenössischen Stücken gegenüber, verlängert also die Geschmacksverirrungen bis in die Gegenwart. Freilich setzt man nun auf andere Prämissen. Verwies für Pazaurek ein „böses“ Ding etwa auf ästhetische oder materielle Mängel, so liegt das Böse heute eher bei „sozialen, ökonomischen und ökologischen Faktoren“, wie es im Ausstellungstext heisst. Wie etwa das mit Schmucksteinen verzierte Handy, das es sogar zum Ding des Monats schaffte.
Besucherinnen werden gebeten, solche Dinge von zu Hause mitbringen; sie werden dann ausgestellt. Oder zerstört: Wohl nur Ende August war die Destruktionsmaschine von Antoine Zgraggen zu Gast, die eine radikale Lösung für das eine oder andere Stück anbot.
Interessant ist auch, dass sich die Einrichtung, die in Deutschland für die guten Dinge schlechthin steht, Sorgen macht, man könne etwas aus ihrem Sortiment in die Ausstellung bringen: so fordert Manufactum in den letzten Hausnachrichten dazu auf, diese Stücke doch bitte zu melden.
Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Januar 2010 zu sehen. Hier ein Einblick zum Hören in Deutschlandradio Kultur und hier etwas zu lesen in der taz und hier auf Fr-online.