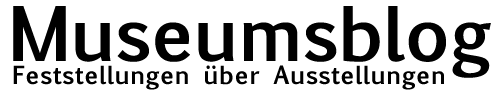Sechs Impressionen zur Documenta
Zu allererst: die Documenta 12 ist ein Erlebnis. Es ist toll, soviel Kunst auf einmal sehen und erfahren zu können. Ich habe spannende Sachen gesehen, die mich mächtig beeindruckt haben, aber auch Langweiliges. Es gehört dazu, dass die Ausstellungsräume viel zu voll sind und dass man am Ende eines Nachmittags nur noch flaniert und eigentlich nichts mehr sehen möchte. Hier einige Impressionen zur Documenta:
1. Faul sein gilt nicht. Im Documenta-Prospekt heisst es, dass die Besucherin die Werke „ästhetisch zueinander in Beziehung“ setzen soll. Deshalb gibt es (fast) keine Informationen zu Werken und KünstlerInnen. Auf den Objekttafeln steht der Name des oder der KünstlerIn, ggf. das Jahr, sowie die verwendeten Materialien. Es kommt auch vor, dass das Werk weder einen Titel hat noch ein Datum und der Name auchz nicht weiterhilft. Einerseits ist das interessant, weil man nicht gleich in das Schubladendenken Mann-Frau- Zeit-Ort verfällt. Wenn man sich darauf einlässt, dann sieht man schon die Zusammenhänge, wie Materialien oder Themen; die Besucherin ist in „das Gespräch“ miteinbezogen, wie es die Documenta-Leitung vorsieht. Andererseits gelingt es nicht immer, sich darauf einzulassen. Katalog oder Audio-Guide wären eine Alternative gewesen. Ich hätte mir aber zuweilen mehr Information gewünscht, ohne dass ich mit einem zwei-Kilo-Katalog oder einem Knopf im Ohr hätte rumlaufen müssen. Manchmal waren Blätter mit Informationen neben einzelnen Kunstwerken geheftet – Konzept oder nachträglich hingehängt?
2. Als Alternative gab es zum ersten Mal einen Audio-Guide. So hilfreich das sein kann: ich ziehe es aber vor, mich mit meiner Begleitung auszutauschen oder mit anderen BesucherInnen ein Gespräch zu beginnen. Viele andere BesucherInnen wählten den Audio-Guide. Leider hatte das zur Folge, dass viele stumm, andächtig und sprachlos vor den Kunstwerken standen oder damit beschäftigt waren, mit der Technik ihres Mp3-Players klarzukommen.
3. Schön fand ich die Grafik des Leitsystems der Documenta, also etwa die Pfeile und die Schrift. Verantwortlich dafür ist die Gruppe? Vier5, die ihren Sitz in Paris hat. Interessanterweise hat dasselbe Büro auch das Logo für das Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt entwickelt (die übereinanderlappenden Buchstaben) – das mir ja gar nicht zusagt.
4. Die Einbindung des Schlosses Wilhelmeshöhe. Das gab es noch nie zuvor, dass eine Documenta hier den Dialog suchte – und leider nicht gefunden hat. Die eine Leitfrage, die Leiter Buergel aufstellte, „Ist die Moderne unsere Antike?“ hätte eigentlich hervorragend in die Präsentation der Antike im Schloss gepasst. Etwa die Themen Körper und Bewegung, mit denen sich unten in der Stadt viele Künstlerinnen beschäftigten. In der Antikensammlung ist aber leider nichts von der Documenta zu finden. Statt dessen läuft man eher verloren durch die ohne Zweifel schöne Gemäldesammlung, auf der Suche nach Documenta-Werken. Neben einigen geschlossenen Präsentationen innerhalb der Ausstellungssäle tritt die zeitgenössische Kunst nur sporadisch und etwas lieblos mit der alten Kunst in den Dialog; das Ganze wirkt wie: Hier haben wir noch etwas Platz, dann können wir doch noch eben mal den oder die soundso hinhängen. Schade! Immerhin habe ich nun endlich Schloss Wilhelmshöhe gesehen und bin gebührend beeindruckt: ein schönes, klassisches Museum, das auch einen Besuch außerhalb der Documenta-Zeit verdient. Das Reisfeld allerdings hätte man sich schenken können.
5. Gut gefallen hat mir das Publikum, dass zum Teil so ausgestattet war, als würde es sich mindestens auf eine 20-Kilometer-Wanderung begeben. Es war nicht das typische bürgerliche-Sonntagsnachmittag-Museumspublikum, sondern ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Gibt es eine Statistik dazu?
6. Auch ein Kunstwerk: Als wir am Spätnachmittag erschöpft im Aue-Pavillon auf den chinesischen Stühlen saßen, durch die verglaste Wand nach daußen blickten und auf eine Animation warteten, die uns ein sehr flüchtig gelesenes Schild versprach, tat sich lange Zeit erstmal nichts. Doch plötzlich, wie von Geisterhand gesteuert, plusterte sich ein draußen am Boden liegender Schlauch auf und einer Schlange gleich huschte sekundenschnell eine Welle an uns vorbei, dann sackte der Schlauch wieder zusammen. Für einen Moment waren wir verunsichert, war es das? Ging es hier nicht um Bewegung, Körperlichkeit und Vergänglichkeit? Um die Animation eines Stückes Alltags? Das war dann doch zu naiv gedacht: Das Schild richtig gelesen, kündigte es eine Flash-Animation in der Dunkelheit an. Irgendwie waren wir darüber enttäuscht.