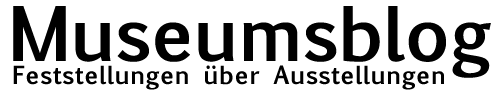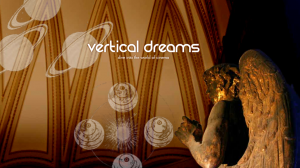Geschrieben von Nina Gorgus am 20. Juli 2010 09:15
Vor über drei Jahren hatte das Ecomusée Ungersheim im Elsass gewaltige Probleme (hier im Blog.)
Damals wurde über die Schließung des (selbstfinanzierten) Museums diskutiert, da die Region keine Subventionen leisten, sondern das Geld lieber in den neuen Freizeitpark Bioscope stecken wollte. Damals war die Zukunft des Museums alles andere als klar – Zeit, mal wieder nachzuschauen, was eigentlich daraus geworden ist. Bislang allerdings nur aus der Ferne.
Das Museum gibt es noch und ist erfolgreicher denn je, wenn man die Besucherzahlen betrachtet: 2009 hat es 163.000 Besucherinnen empfangen.
Nachlesen konnte ich Details über den Auftakt der Saison 2010. Mit der
Compagnie des Alpes, die das Museum und den Freizeitpark Bioscope über 3 Jahre gemeinsam betrieb, verbindet das Museum so gut wie nichts mehr; die Gesellschaft betreibt über eine Tochtergesellschaft nur noch Boutique, Hotel und Restaurant im Museum.
Ein neuer Direktor, Pascal Schmitt, leitet nun die Geschicke des Museums. Sein Rezept, das so erfolgreich ist, setzt auf ganzheitliches Erleben.
Das Motto des Museums heisst: „Tant d’histoires à raconter“. Der Slogan wurde auch für die deutschen und schweizerischen BesucherInnen eingedeutscht: „So viel zu erleben“.
„Im Écomusée d’Alsace sind Sie mehr als
nur ein Zuschauer! Kinder und Erwachsene
nehmen sich die Freiheit und
erkunden Dorf und Landschaft auf
eigenen Wegen. Entdecken Sie Geschichte
und Geschichten, vielleicht sogar
auch ein Teil Ihrer eigenen Geschichte…“
Konsultiert man die Presse-Broschüre, die man sich auf der Seite des Museums herunterladen kann, so boomt der Nostalgie-Freizeitpark à l’alsacien: im typisch elsässichen Dorf, das das Frelichtmuseum nachbilden soll, gibt es allerlei Aktivitäten, die insbesondere Jahreszeiten und Festtage berücksichtigt. Im Juli können Kinder und Jugendliche das ländliche Leben gar selbst ausprobieren, und nach dem Wecken durch den Hahn den Tag mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten erleben. Im Blog des Museums sieht man dann auch Mädchen, die in Tracht Hasen füttern.
„Bewohnerinnen“ gibt es anscheinend sowieso: die Besucherbetreuung in Form von verkleideten Schaustellern, die den Töpfer oder den Schmied mimen. Hinzukommen, glaubt man den oben erwähnten Artikel, gleich zwei Familien, die im Sommer am Sonntag zwei Häuser bespielen, was natürlich sehr an die Anfänge des Freilichtmuseums Skansen erinnert.
Freuen können wir uns jetzt auch schon auf Weihnachten:
„So richtig authentisch und schön wird Weihnachten erst im Écomusée d’Alsace“ heisst es in der Gebrauchsanweisung im Internet. Hier würde mich natürlich interessieren, wie authentisch definiert wird!
Auch die gerade laufende Wechselausstellung mit dem Titel „Stoffe und Leute“, deren Inhalt ich in einem PDF nachvollziehen kann, vermittelt nicht den Eindruck einer sozialgeschichtlichen, analytischen Betrachtungsweise.
„Die ganze Kommune bildet ein lebendiges Museum, dessen Publikum sich im Innern befindet. Ein Ecomusée hat keine Besucher, sondern Bewohner“, so hatte 1972 Hugues de Varine, der Erfinder der Bezeichnung Écomusee, das Vorhaben für das Ecomusée le Creusot umschrieben.
Was in Ungersheim umgesetzt wird, hat aber meines Erachtens nichts damit zu tun, d.h. mit der Vorstellung von Partizipation der Bevölkerung an der Entstehung eines Museums (ein Gedanke, der gerade wieder Konjunktur hat), wenig zu tun. Oder täusche ich mich da?
Die Badische Zeitung berichtete im März 2010 über einen Besuch im ecomusée. Die Zeitung DNA Region berichtete auch über den Saisonstart.
Ob der Ziegenbock in Ungersheim noch zugange ist, ist eher ungewiss: er wurde bereits Mitte der 1990er Jahre von U. Hägele fotografiert.