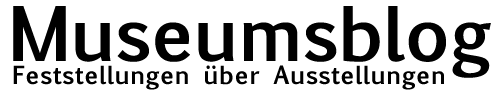Die Herkunft der Dinge
Wenn man einmal so überlegt, was die Museen weltweit miteinander verbindet, ist es eigentlich nicht der Bildungsauftrag, noch das Ansinnen, das kulturelle Erbe möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Nein, es ist die Sorge, möglicherweise ein Objekt in der Sammlung zu haben, das unter dubiosen Umständen ins Museum kam. Möglichkeiten gibt es hier viele: etwa die Stücke, die die Nazis jüdischen Sammlern abpressten und die irgendwie in die Museen kamen; die Objekte, die in den Wirren des zweiten Weltkrieges mitgenommen wurden oder die Stücke, die durch Kolonialismus abhanden gekommen sind. Hier ist es besonders krass: Über 95 Prozent des afrikanischen Patrimoine, so war dieser Tage auf einer Veranstaltung der UNESCO in Paris zu hören, ist in Museen auf anderen Kontinenten zu finden. (Dass die etablierten Museumsdirektoren davon nichts hören wollten, wundert nicht).
Eine weitere Variante, Objekte ohne Stammbaum zu vertreiben, findet man in Italien. Dort verschwinden wohl seit Jahren im großen Stil Stücke aus Museen oder von Ausgrabungen, die dann später in großen amerikanischen Museen wieder auftauchen. Den Drahtziehern ist man auf die Spur gekommen und in Rom läuft gerade ein Prozess gegen eine ehemalige Angestellte des J. Paul Getty Museums in Los Angeles, die für ihren Arbeitgeber im großen Stil auf diese Weise eingekauft hat. Der Bericht über ihre Machenschaften und die der anderen Kunsträuber (in der FAZ vom 10.2.2007) liest sich wie ein gut ausgedachter Krimi.
Eine weitere Gemeinsamkeit der Museen ist, dass die betroffene Institutionen bzw. die als Diebe veurteilten Hehler oft argumentieren: Es ist ja nicht so wichtig, wie das Stück in die betreffende Institution gekommen ist (also ob durch Raub, Erpressung oder Hehlerei), sondern dass das Stück hier ohne Zweifel am allerbesten präsentiert werde. Zynisch ist auch die Antwort, die die Vertreterin von ICOM dem Vertreter aus Afrika auf der UNESCO-Veranstaltung gab: Heute sei man ja mit der Digitalisierung von Bildern schon so weit, dass man sich in Afrika die Dinge auf dem Bildschirm anschauen und auf diese Weise am kulturellen Erbe teilhaben könne. Wie war das nochmals mit den Originalen?