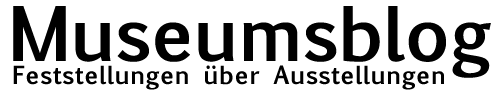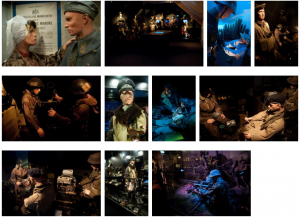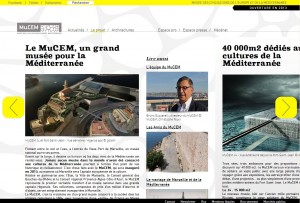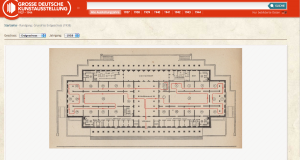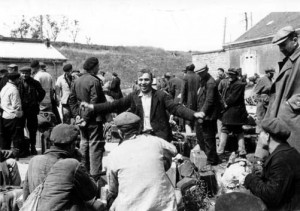Geschrieben von Nina Gorgus am 7. Oktober 2011 22:01
Das Landeszeughaus, die Museumsakademie, und ICOMAM hatten zur Tagung „Does war belong in Museums? The Representation of Violence in Exhibitions“ geladen, und sehr viele Teilnehmer/innen kamen Ende September nach Graz, um darüber im internationalen Kreis zu diskutieren. Auch der Grazer Flughafen ist ganz auf das Thema eingestimmt.

Das Tagungsprogramm war dicht und gut verwoben – Drahtzieher hierfür war Gottfried Fliedl.
Den Auftakt bildete die Theorie und hier legte der keynote speaker Jay Winter, der Experte für die Musealisierung des Ersten und Zweiten Weltkriegs eine gute Basis. Er präsentierte eine Übersicht über Museumspraktiken in den letzten Jahrzehnten und bereicherte die Diskussionen der folgenden Tage erheblich.
Auf ein paar Aspekte möchte ich hier kurz eingehen. Interessant fand ich vor allem die Präsentation von Museen, die gerade entstehen bzw. sich verändern. So können wir demnächst im Zeughaus in Solothurn eine neue Sicht auf alte Rüstungen erwarten. Dass man auch in einem Panzermuseum Anschluss an die Kultur- und Sozialgeschichte suchen kann, ja sollte, machte der wissenschaftliche Leiter Ralf Raths eindrücklich klar. Das Museum in Munster, das sich, wie der Name schon sagt, Panzern widmet, befindet sich in einer Umorientierungsphase. Das hat Dresden schon hinter sich: Gorch Pieken stellte das Militärhistorische Museum der Bundeswehr vor, das so ganz mit den übrlichen Praktiken bricht. Die BesucherInnen erwartet keine der übliche Waffengalerien, wie sie etwa im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien oder im Armeemuseum in Paris zu sehen sind. Ob das Konzept tatsächlich aufgeht, die Kulturgeschichte der Gewalt auszustellen, können wir schon nächste Woche selbst überprüfen: am 14. Oktober ist Eröffnung.
Spannend war auch der Vortrag von Susanne Hagemann aus Berlin, die sich in deutschen Stadtmuseen umgeschaut hat und eine museologische Kanonisierung des Zweiten Weltkriegs festgestellt hat: Zum üblichen Repertoire gehören zum Beispiel Hitlerbüste, ein Modell der jewiligen zerstörten Stadt, und vor allem: eine Bombe, gerne liegend.
Aus der Schweiz, genauer aus dem Museum zu Allerheiligen, stammt diese Bomben-Präsentation.

Auf der Tagung wurde vor allem eines deutlich: nationale Strategien spielen in den militärgeschichtlichen Museen eine besondere Rolle. Gerne beschäftigt man sich auch mit den abgeschlossenen, bereits historisierten Kriegen. Waffen und Rüstungen aus den früheren Jahrhunderten werden gerne ästhetisierend gezeigt;
Die Frage der Tagung konnte natürlich nicht eindeutig beantwortet werden; es waren sich aber doch fast alle einig, dass Krieg natürlich ins Museum gehört. Doch wie soll er dargestellt werden? Das Historial in Peronne, das den Ersten Weltkrieg aus drei Perspektiven (der ehemaligen Gegner) zeigt, galt auch hier als Ideal – das aber doch bislang keine nachhaltigen Wirkung auf andere Museen hatte. Vielleicht ändert sich das jetzt etwas mit Dresden?